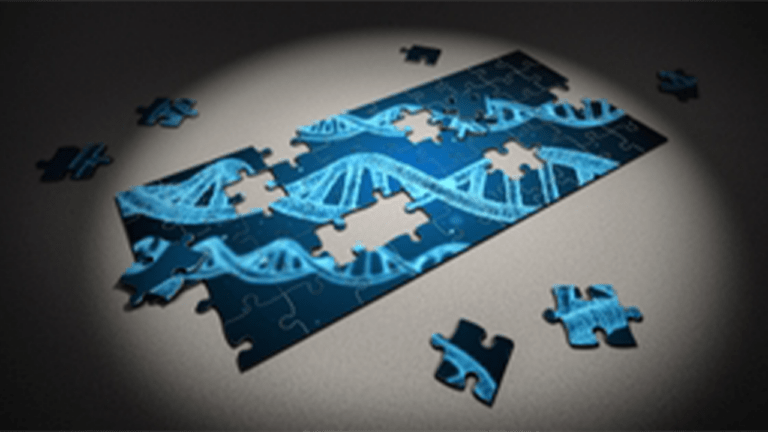Das E-Learning-Mikroprogramm umfasst eine Reihe von ansprechenden Videos (jeweils ca. 5 Minuten lang), die einen Überblick über die grundlegenden Konzepte der Parkinson-Krankheit zu den Themen Klinik, Genetik, Datenanalyse und GP2-Ressourcen bieten. Dank ihrer prägnanten Konzeption sind die Videos leicht zugänglich, wecken das Interesse und die Motivation. Sie sorgen für schnelle und wirkungsvolle Lerneffekte und ermöglichen es, sich über grundlegende Konzepte und aktuelle Fortschritte in der Parkinson-Forschung auf dem Laufenden zu halten.
Die Reihe „Klinik“ beschäftigt sich mit den vorrangigen Merkmalen der Parkinson-Krankheit. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den Themen klinische Diagnose, Symptome, Verlauf und Behandlung. Diese Videos sollen ein vertieftes Verständnis dafür vermitteln, wie sich die #Parkinson-Krankheit in verschiedenen Bevölkerungsgruppen äußert und die wichtige Rolle der klinischen Phänotypisierung in der Forschung hervorheben. Diese Serie gibt Lernenden Tools an die Hand, mit denen sich Zusammenhänge zwischen klinischen Beobachtungen und umfassenderen Forschungs- und Behandlungsstrategien herstellen lassen.
Überblick über Behandlungsmöglichkeiten bei Morbus Parkinson
Informieren Sie sich über Behandlungsmöglichkeiten bei Parkinson, zum Beispiel orale Arzneimittel wie Levodopa oder gerätegestützte Therapien wie Tiefenhirnstimulation und kontinuierliche Medikamenteninfusion. Erfahren Sie, wie wichtig ein maßgeschneiderter multidisziplinärer Ansatz zur Behandlung motorischer und nicht-motorischer Symptome ist, und informieren Sie sich über laufende Forschungsarbeiten zu verlaufsmodifizierenden Interventionen.
Kognitive Beurteilung bei Parkinson
Erfahren Sie mehr über kognitive Beeinträchtigungen bei Parkinson sowie verschiedene Bewertungstools für die Diagnose von #Demenz und leichten kognitiven Beeinträchtigungen. In dieser Episode wird hervorgehoben, wie wichtig es ist, kulturell angemessene Tools auszuwählen und mögliche Verzerrungen aufgrund des Bildungsstands oder der Sprache zu berücksichtigen, um akkurate kognitive Beurteilungen bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten.
Beurteilungsskalen für die motorische Progression
In diesem Video wird die Bedeutung von Beurteilungsskalen für die motorische Progression bei Parkinson erörtert. Den Schwerpunkt bilden hierbei die Skalen MDS-UPDRS und Hoehn & Yahr, die zur Beurteilung motorischer Symptome und des Krankheitsverlaufs genutzt werden. Dabei werden auch Herausforderungen und potenzielle Fallstricke bei der Verwendung dieser Skalen hervorgehoben.
Neurobildgebung bei der Diagnose von Morbus Parkinson
Erfahren Sie mehr über die Rolle der Neurobildgebung für die Diagnose von Parkinson, einschließlich der Frage, wie es durch MRT- und molekulare Bildgebungsverfahren wie PET und SPECT möglich ist, die Parkinson-Krankheit von anderen Erkrankungen zu unterscheiden, das Fortschreiten der Krankheit zu beurteilen und #Neurodegeneration zu erkennen.
Die Reihe „Genetik“ splittet die Komplexität der Parkinson-Genetik in Themenfelder wie Erblichkeit, familiäre versus sporadische Fälle und die Auswirkungen bekannter genetischer Parkinson-Risikofaktoren auf. Außerdem werden genomweite Assoziationsstudien (GWAS) und ihre Rolle bei der Identifizierung neuer therapeutischer Ziele untersucht. Diese Reihe streicht heraus, wie wichtig die Integration der Genetik in die Parkinson-Forschung im Sinne eines besseren Verständnisses der Krankheitsmechanismen ist.
Variantenpriorisierung
Machen Sie sich mit den Priorisierungs- und Klassifizierungsprozessen für verschiedene genetische Varianten vertraut und erfahren Sie, wie sich relevante Varianten für die Parkinson-Krankheit mithilfe verschiedener Datenbanken und bioinformatischer Tools identifizieren lassen. In dieser Episode werden auch die ACMG-Richtlinien für die Klassifizierung von Varianten in Kategorien wie gutartig, pathogen und VUS (Varianten mit unklarer Signifikanz) erörtert, wobei die Bedeutung einer sorgfältigen Interpretation und fortlaufenden Neuklassifizierung betont wird.
Zusammenhang zwischen MAPT H1/H2 und Parkinson
In diesem Video wird der Zusammenhang zwischen den Haplotypen MAPT H1 und H2 und der Parkinson-Krankheit untersucht und dabei herausgestrichen, in welcher Weise der H1-Haplotyp mit einem erhöhten Krankheitsrisiko und spezifischen motorischen Phänotypen assoziiert ist. Es wird ebenfalls erörtert, welchen Einfluss die ethnische Zugehörigkeit auf die Stärke dieses Zusammenhangs haben kann, da die Ergebnisse für verschiedene Bevölkerungsgruppen divergieren.
LRRK2
Erfahren Sie, welche Rolle das LRRK2-Gen als genetischer Risikofaktor für die Parkinson-Krankheit, die assoziierten Proteinfunktionen und die Auswirkungen von Mutationen, insbesondere der G2019S-Variante, spielt. Diese Episode befasst sich mit dem aktuellen Forschungsstand zu gezielten Therapien, die darauf abzielen, die LRRK2-Aktivität zu hemmen oder das Gen herunterzuregulieren, und geht dabei auf Herausforderungen wie die variable Penetranz von Mutationen und mögliche Nebenwirkungen ein.
Parkinson-Risikofaktor: GBA1
Erfahren Sie mehr über GBA1 als einen der wichtigsten genetischen Risikofaktoren für die Parkinson-Krankheit. GBA1-Mutationen verursachen Protein-Fehlfaltungen, die die zellulären Signalwege stören und zur #Neurodegeneration beitragen. Bei betroffenen Personen treten die Symptome früher auf, schreiten schneller voran und führen zu einem stärkeren kognitiven Verfall, was den Bedarf an gezielten therapeutischen Strategien verdeutlicht.
PARK2
Dieses Video befasst sich mit dem PARK2-Gen, einer der Hauptursachen für die früh-adulte Parkinson-Krankheit, und beschreibt detailliert seine verschiedenen Mutationen. Es erläutert auch die Funktion des Parkin-Proteins bei der Aufrechterhaltung der Qualität der Mitochondrienfunktion, die klinischen Symptome der PARK2-assoziierten Parkinson-Krankheit und die Entstehung von Mutationen durch unabhängige Ereignisse oder Gründereffekte bei bestimmten Populationen.
GWAS – Parkinson-Risiko, Erkrankungsalter und Krankheitsverlauf
Erfahren Sie mehr über den Einsatz von genomweiten Assoziationsstudien (GWAS) zur Identifizierung genetischer Faktoren, die mit dem Parkinson-Risiko, dem Erkrankungsalter und dem Krankheitsverlauf in Zusammenhang stehen. In dieser Episode werden aktuelle GWAS-Erkenntnisse für verschiedene Populationen vorgestellt. Des Weiteren wird diskutiert, wie diese Studien zu einem besseren Verständnis der Krankheit beitragen können, unter anderem betreffend neue Risikoloci und potenzielle therapeutische Ziele.
In der Reihe „Datenanalyse“ werden wichtige Methoden und Tools für die Analyse von #Parkinson-spezifischen Datensätzen vorgestellt. Die verschiedenen Videos sollen die Lernenden jeweils dazu befähigen, Daten souverän zu analysieren und diese Methoden auf ihre eigene Parkinson-Forschung anzuwenden.
Cluster-Plots: Verarbeitung und Anzeige von Illumina-Plots
Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Cluster-Plots zur Visualisierung von Proben-Genotypen, zur Beurteilung der Genotypisierungsqualität und zur Detektierung von Kopienzahlvarianten. In dieser Episode wird behandelt, wie man diese Plots mit dem GP2-Kohortenbrowser anzeigen und wie man benutzerdefinierte Plots mit Python für weitere Analysen erstellen kann.
Power-Berechnungen
Informieren Sie sich über die Bedeutung von Power-Berechnungen bei genetischen Analysen zur #Parkinson-Krankheit – wie Hypothesentests, Fehlertypen und Faktoren wie Alpha, Effektgröße und Stichprobengröße, die Einfluss auf die statistische Power haben.
Kopienzahlvarianten mithilfe von Genotypisierungsdaten
Dieses Video erörtert, wie Kopienzahlvarianten (CNV) bei der Parkinson-Krankheit mithilfe von Genotypisierungsdaten analysiert werden, wobei für die Identifizierung potenzieller CNVs der Schwerpunkt auf der B-Allel-Frequenz und dem log-R-Verhältnis liegt. Es werden die Vorteile und Grenzen dieser Methode herausgearbeitet, einschließlich ihrer Skalierbarkeit für große Datensätze und der Notwendigkeit einer weiteren Validierung mit Techniken wie MLPA oder Long-Read-Sequenzierung.
Mitochondriale DNA-Analyse
In diesem Video werden zwei primäre Ansätze zur mitochondrialen DNA-Analyse im Zusammenhang mit der Parkinson-Krankheit untersucht: das Detektieren von Varianten (Variant-Calling) mit dem Tool Mutect2 und die Haplogruppen-Analyse mit Haplogrep. Es wird auch herausgearbeitet, welche Herausforderungen mit der mitochondrialen DNA einhergehen, etwa ihre zirkuläre Struktur und ihre hohen Mutationsraten; zudem werden die Grenzen dieser Analysemethoden diskutiert.
Lokale Abstammung
Erfahren Sie mehr über die Konzepte der genetischen und lokalen Abstammung und verstehen Sie so, wie die lokale Abstammung in Genotyp-Phänotyp-Studien zur besseren Erkennung von abstammungsspezifischen Risikoloci eingesetzt werden kann. In dieser Episode werden Methoden wie Admixture-Mapping und Tractor vorgestellt, mit denen sich – durch die Berücksichtigung der Bevölkerungsvielfalt bei der Krankheitsforschung – die Aussagekraft genetischer Studien verbessern lässt.
In der Reihe „GP2-Ressourcen“ werden die von GP2 bereitgestellten Tools, Daten und Kooperationsangebote präsentiert. Sie umfasst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Zugriff auf mehrstufige Daten (Tiered Data) und zeigt, mit welchen Initiativen Forschende auf der ganzen Welt in ihrer Arbeit unterstützt werden. Diese Serie bringt zur Geltung, wie engagiert GP2 sich für den Zugang zu Ressourcen und den Aufbau von Partnerschaften einsetzt, die den Fortschritt in der Parkinson-Forschung beschleunigen.
Daten- und Code-Verbreitung: GitHub und Zenodo
Erfahren Sie, wie Sie Plattformen wie GitHub und Zenodo für die Versionskontrolle sowie den öffentlichen Zugang und die Zitierbarkeit von Code nutzen können. Diese Tools spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung von Transparenz, Reproduzierbarkeit und Zusammenarbeit und stehen gleichzeitig im Einklang mit den Richtlinien von GP2 und ASAP.