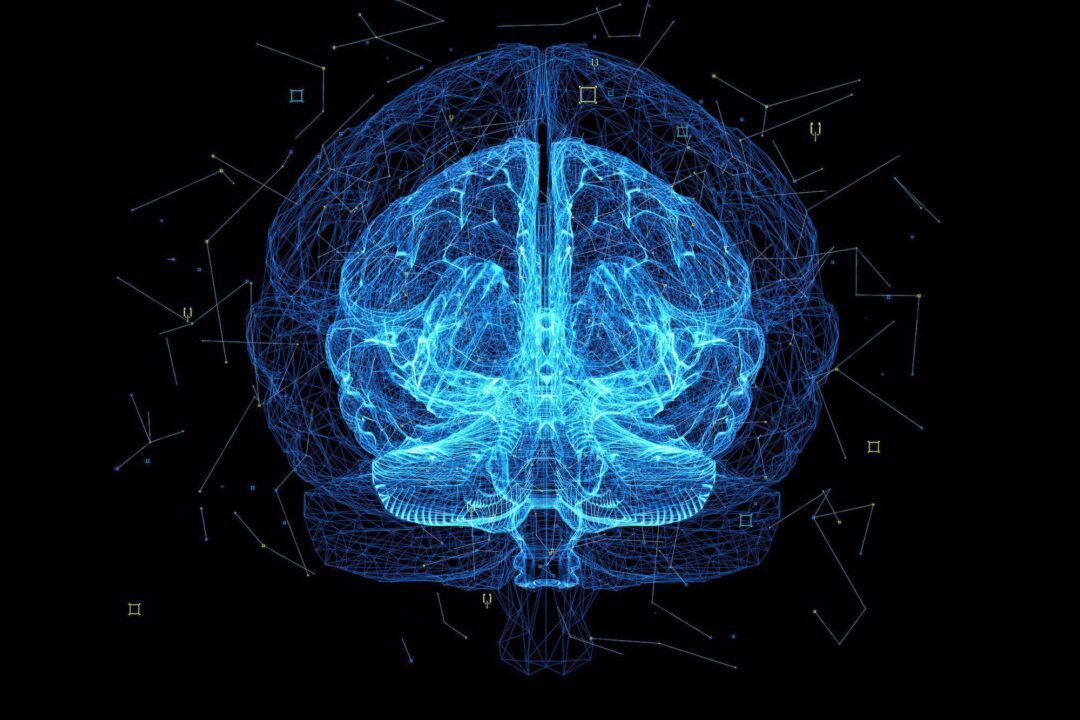Ich hatte schon immer eine sehr lebhafte Fantasie. Als Kind starrte ich häufig auf meine Hand und linste tief hinein in die Hautfalten, um dort Welten zu entdecken, die sich mit außerirdischem Leben zusammengetan hatten. Ich stellte mir vor, dass dort ganze Zivilisationen lebten, die nicht wussten, dass ihre gesamte Realität in eine Ritze meiner Haut passte und dass alles, was sie taten, einen Beitrag zu Systemen leistete, die mir die Existenz ermöglichten. Allerdings war mir dabei nicht bewusst, dass ich gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt war.
In jedem von uns steckt eine Symphonie des Lebens, die allerdings viel komplexer und dynamischer ist, als ich es mir je hätte erträumen können. Wir sind eine fein austarierte Anordnung von miteinander verbundenen biologischen Systemen, welche aus Kombinationen von nur zwanzig Aminosäuren in einer aufgereihten Doppelhelix aus vier Nukleinsäuren bestehen, die durch uns der gesamten Existenz einen Sinn verleiht.
Carl Sagan hat einmal witzigerweise gesagt: „Wir sind eine Möglichkeit für den Kosmos, sich selbst zu erkennen.“ Doch das ist ein wenig selbstverherrlichend: „Wir“ sind bloß ein Produkt der erlernten Mechanismen des Lebens, geformt durch Äonen des Ausprobierens. Jeder stochastische Schritt vorwärts hat unsere Fitness gestärkt und uns mit den Eigenschaften ausgestattet, die wir brauchen, um weiter zu forschen und mehr über uns selbst und das Universum, in dem wir zufälligerweise leben, zu erfahren.
Eine merkwürdige Eigenart unserer Existenz, die uns von allem anderen Leben, das wir kennen, unterscheidet, besteht darin, dass wir uns immer gefragt haben, wie und warum wir entstanden sind. Einige von uns, die sich nicht mit den Geschichten ihrer Zeit zufrieden geben wollten, bohrten und stocherten weiter und erschufen das Werkzeug, das unsere Fähigkeit zur Erforschung des Unbekannten erweiterte – und trieben damit unser Verständnis von allem Existierenden voran.
Eine wesentliche Lektion aus allem, was wir gelernt haben, ist, dass das Leben nie aufhört vor sich hin zu tüfteln und zu basteln. Es ist ein ewiger Prozess der Selbstverbesserung, angetrieben durch endlose Variationen und feinste Veränderungen an unserer genetischen Ausstattung. Meistens haben diese Veränderungen wenig bis keine Wirkung. Mitunter bewirken sie einen Vorteil.
Hin und wieder fordern diese Veränderungen jedoch einen Tribut, der furchtbar grausam erscheinen kann.
Es ist zehn Jahre her, seit meine Symptome zum ersten Mal auftraten. Wahrscheinlich begann schon vor zwanzig oder mehr Jahren etwas falsch zu laufen. Ich bin zwar froh, dass der Abbau allmählich verlaufen ist, werde mir aber des unerbittlichen Fortschreitens immer deutlicher bewusst. Es gibt für mich heute nur noch selten Momente, in denen ich seine Auswirkungen nicht bemerke, denn er beeinträchtigt quasi alles, was ich tue – auch das Tippen der Worte, die Sie hier lesen.
Einen Großteil davon habe ich entweder im ausgeschalteten Zustand geschrieben und versucht, meine steifen und bradykinetischen Arme und Finger geschickt genug zu bewegen, um das zu tippen, was ich wollte, oder im eingeschalteten Zustand und versucht, das durch die Dyskinesie verursachte unregelmäßige Schlagen meines rechten Arms und Beins unter Kontrolle zu bringen. Das ist beängstigend, wenn man überlegt, wie schwierig das wohl in 10 Jahren sein wird. Es ergibt jedoch keinen Sinn, über die Zukunft nachzusinnen, denn jeder heutige Augenblick verlangt mir schon zu viel ab, und es gibt doch noch so viel zu tun.
Gestützt auf die gesammelte Weisheit zahlloser Generationen unzufriedener Bastler sind wir der Lösung einiger der kniffligsten Rätsel darüber, was tief in unserem Inneren schief läuft, näher als je zuvor. Trotz der nach wie vor gewaltigen Lücke zwischen dem, was wir wissen, und dem, was wir an Wissen brauchen, gibt es guten Grund zu glauben, dass unsere Fortschritte Schlüsselerkenntnisse dazu liefern werden, weshalb unsere Systeme aus dem Ruder laufen, und dass sie uns das Rüstzeug an die Hand geben, um angemessen zu intervenieren.
Von zentraler Bedeutung für dieses Ziel sind Hinweise, die tief in den Bauplänen der mikroskopisch kleinen Molekülmaschinerie verborgen sind, die uns zu dem macht, was wir sind – unser Genom. Im überwiegenden Teil unserer Geschichte wurde das Wissen über das Leben in Form von Geschichten erst mündlich und später schriftlich von Generation zu Generation überliefert. In den letzten Jahrzehnten haben wir jedoch gelernt, dass der tief in allen von uns verschlüsselte Datensatz robuster ist und mehr Erkenntnisse birgt als alles, was wir niedergeschrieben haben.
Von den HOX-Genen, die unsere Entwicklung steuern – und jeder Zelle sagen, wann und wie sie wachsen soll – bis hin zum ARC-Gen, das uns durch eine frühere Begegnung mit viraler RNA verliehen wurde und für unsere Fähigkeit zur Bildung von Erinnerungen von entscheidender Bedeutung zu sein scheint, bis hin zum gesamten horizontalen Transfer von genetischem Material zwischen unseren Zellen und der enormen Vielfalt an Mikrobiota in uns: Unsere neu entdeckte Fähigkeit, den genetischen Code des Lebens zu entschlüsseln, zeigt uns, wer wir wirklich sind, und gibt uns zugleich neue Ziele in die Hand, die wir in unserem langwierigen Kampf gegen Krankheiten möglicherweise angehen können.
Wenn es jedoch um das degenerierende menschliche Gehirn geht, müssen sich die von uns entschlüsselten genetischen Treffer erst noch als zielführend erweisen. Heutzutage können wir den Patient*innen maximal sagen, dass sie Gen X haben, und dass es mit Krankheit Y assoziiert ist. Aber abgesehen von der Aufnahme in ein paar experimentelle Studien (falls vorhanden) gibt es für sie und ihre Ärzt*innen nichts, was sie bislang mit dieser Information anfangen können.
Von Zeit zu Zeit bitte ich einige der mir bekannten Biologen, die Augen zu schließen und sich vorzustellen, was alles in nur einer der 37 Billionen Zellen vor sich geht, die uns zu dem machen, was wir sind. Wie Frau Frizzle, die in der Sendung „Der Zauberschulbus“ mit ihrer Klasse auf Reisen geht, bitte ich sie, mich auf eine Tour zu dem mitzunehmen, was sie vor ihrem inneren Auge sehen. Schnell wird dann klar, wie unvollständig dieses Bild ist und wie viel davon wir mit Geschichten darüber füllen, was wir zu wissen meinen. Glücklicherweise werden jedoch rasche Fortschritte gemacht.
Da denke ich zehn Jahre zurück, als ich erstmals merkte, dass irgendetwas in mir nicht stimmt – und an all das, was wir seither über Mosaizismus, Epigenetik, posttranslationale Modifikationen, Pleiotropie, Epistase und vieles mehr gelernt haben. All das verwandelt sich derzeit von etwas völlig Fremdartigem in etwas, was wir allmählich verstehen lernen und was zugleich eine kritische Rolle in unserem kollektiven Kampf gegen die Krankheit spielt.
Was werden wir aus der Sequenzierung von 150.000 Menschen mit Parkinson-Diagnose lernen? Welche neuen Erkenntnisse darüber, was bei jeder einzelnen Person falsch läuft, werden wir erlangen? Wie viele Zielmoleküle für medikamentöse Behandlungen werden auftauchen? Wie bei jeder Erkundung des Unbekannten liegt auch hier die Schönheit teils in dem, was wir nicht wissen. Wir wissen zwar, dass die Genetik allein uns nicht dorthin bringen wird, wo wir letztendlich hingelangen wollen, aber wir wissen, dass sie ein Wissensfundament bilden wird, auf dem neue Therapieformen entstehen werden. Und dass wir mit ihr auf dem Weg dorthin die Detailinformationen ergänzen können, die sich uns bislang entziehen – über das Leben und darüber, was es tief in den Falten unserer Haut anstellt.